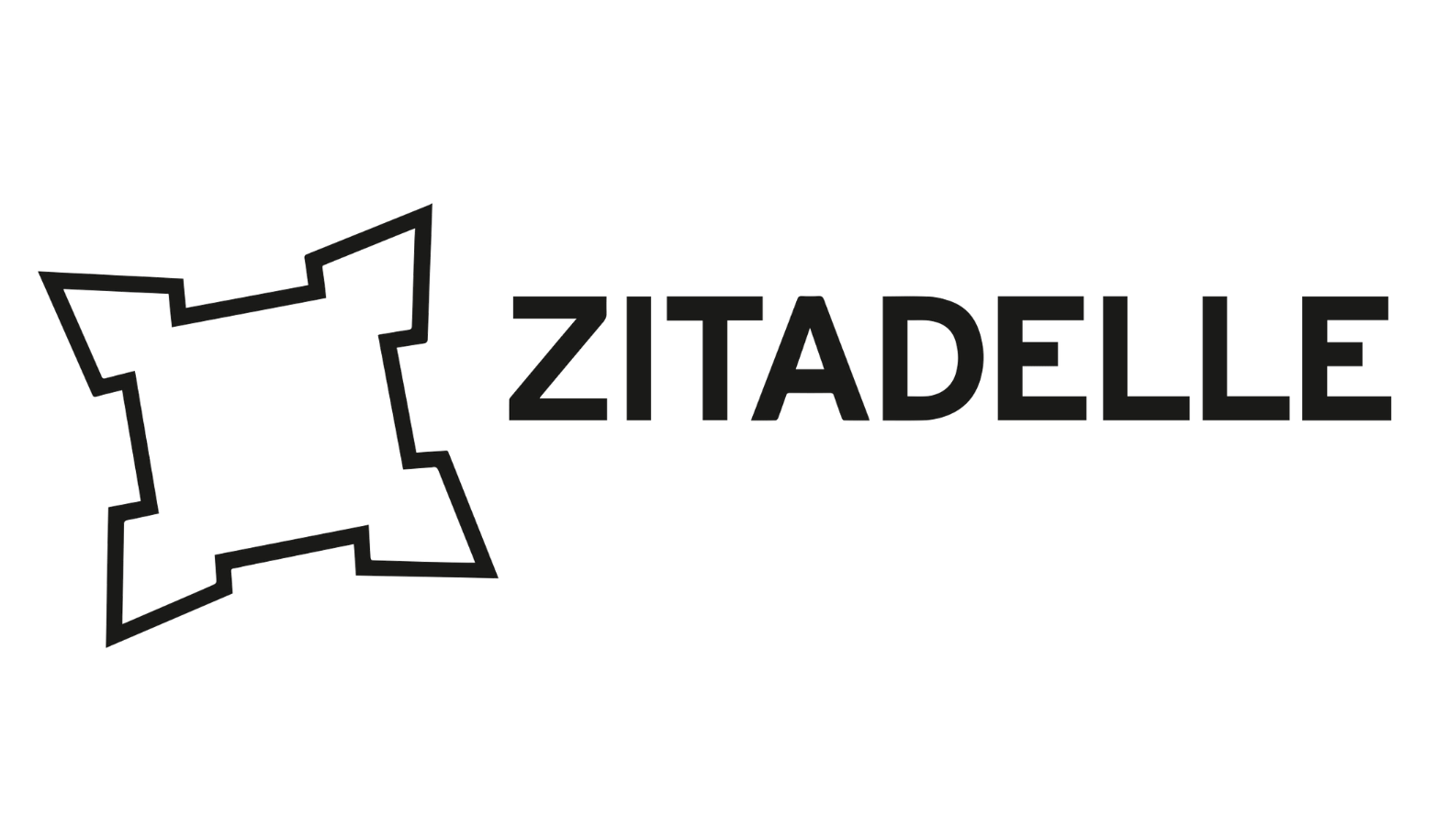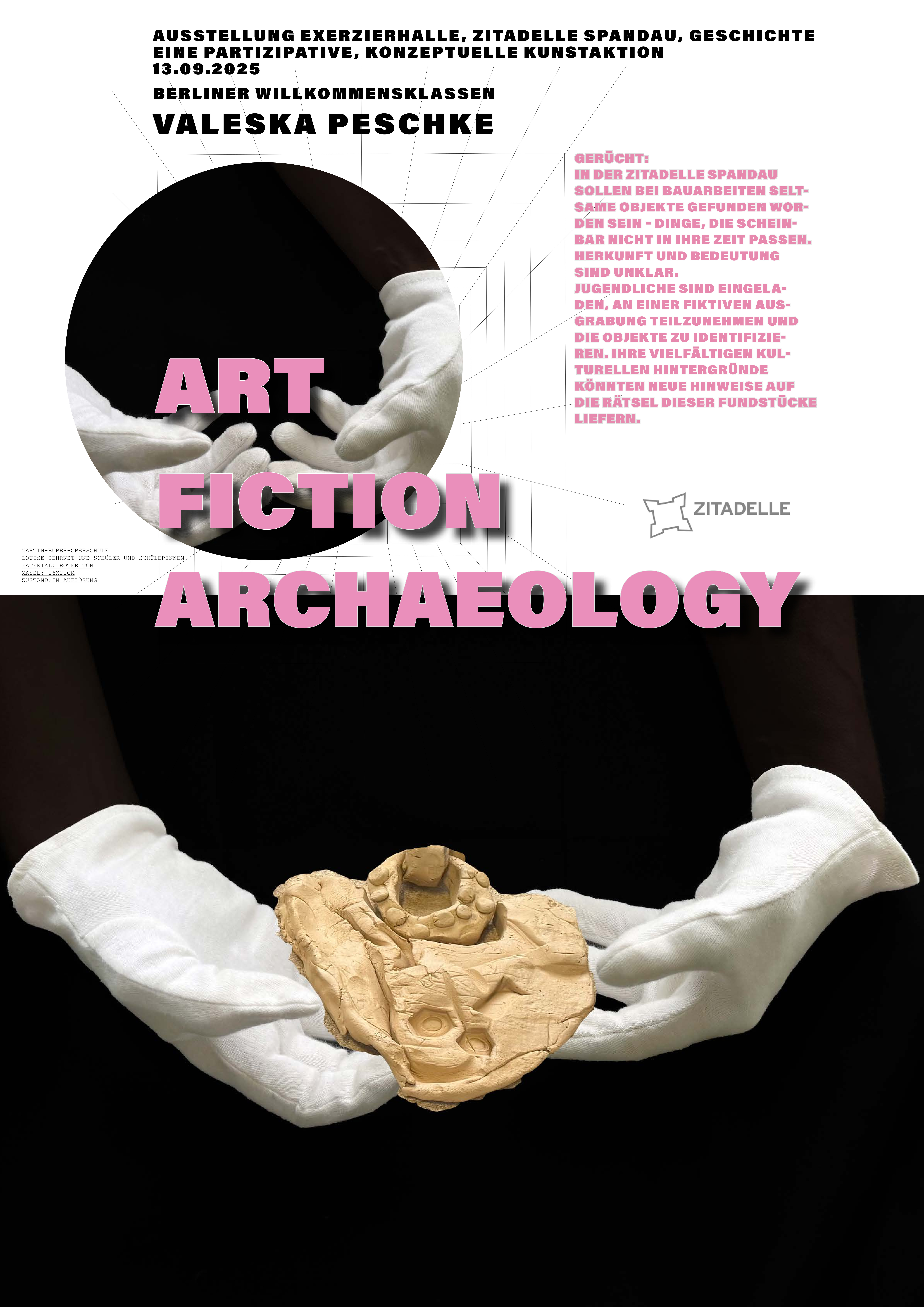Gerücht: In der Zitadelle Spandau sollen bei Bauarbeiten seltsame Objekte gefunden worden sein – Dinge, die scheinbar nicht in ihre Zeit passen. Herkunft und Bedeutung unklar.
Jugendliche sind eingeladen, an einer fiktiven Ausgrabung teilzunehmen und Objekte zu identifizieren. Ihre vielfältigen kulturelle Hintergründe könnten neue Hinweise auf die Rätsel dieser Fundstücke liefern.
«Art Fiction Archaeology» ist eine spekulative, partizipative Spurensuche an der Schnittstelle von Geschichte, Fiktion und kollektiver Vorstellungskraft. Die Arbeit basiert auf einem Konzept von Büro Stefan Iglhaut (Machbarkeitsstudie für das Museum Zitadelle Spandau, 2023) und lädt Jugendliche mit Flucht- und Migrationshintergrund dazu ein, historische Narrative künstlerisch zu befragen und neu zu erzählen.
In drei Werkstattphasen – Zeichnung, Ornament, Keramik – wurden die Teilnehmenden zu „fiktionalen Archäolog*innen“. Sie entwickelten eigene Artefakte, Ornamente und architektonische Fragmente, die persönliche Erfahrungen mit kollektiver Imagination verbinden. Auffällig war die Hinwendung zu Naturmotiven – Pflanzen, Blumen, organische Strukturen – statt der erwarteten Rückgriffe auf heimatliche Muster. Ton wurde zum Medium der Transformation: Die entstandenen Objekte wurden vermessen, beschrieben und als archäologische Funde einer erfundenen Vergangenheit behandelt. Diese sorgsame Aufarbeitung verlieh ihnen Wert und Bedeutung. Das Projekt versteht das Museum nicht nur als Ort der Bewahrung, sondern als Raum der Erfindung. «Art Fiction Archaeology» zeigt, wie Fiktion als künstlerische Methode neue Perspektiven eröffnet – und wie junge Menschen ihre kulturelle Erinnerung aktiv mitgestalten können.
Zeugnisse der Militärgeschichte
Die ehemalige Exerzierhalle beherbergt eine Ausstellung mit historischen Kanonen, unter anderem Prunkgeschützen aus dem 16. Jahrhundert. Die Waffensammlung erinnert zudem daran, dass Spandau seit dem 18. Jahrhundert als Waffenschmiede Preußens galt. Unweit der Zitadelle befanden sich Manufakturen, später Fabriken für die Produktion von Gewehren, Geschützen und Schießpulver. Während des Ersten Weltkrieges arbeiteten hier bis zu 70.000 Menschen in der Rüstungsindustrie, noch wesentlich mehr allerdings ab 1935 nach dem offenen Bruch des Versailler Vertrags durch die nationalsozialistische Regierung. In der Ausstellung sind neben den Waffen weitere militärische Objekte wie Uniformteile und Regimentsfahnen zu sehen. In drei Werkstattphasen – Zeichnung, Ornament, Keramik – wurden die Teilnehmenden zu „fiktionalen Archäolog*innen“. Sie entwickelten eigene Artefakte, Ornamente und architektonische Fragmente, die persönliche Erfahrungen mit kollektiver Imagination verbinden.
Willkommensklassen 2024
Martin-Buber-Oberschule: Louise Sehrndt und Schüler*innen. Bertolt-Brecht-Oberschule: Ewa Lipska und Schüler*innen. Arndt-Gymnasium Dahlem: Dr. Gülseren Aslan und Schüler*innen.
GRAFIK: Valeska Peschke, 2025